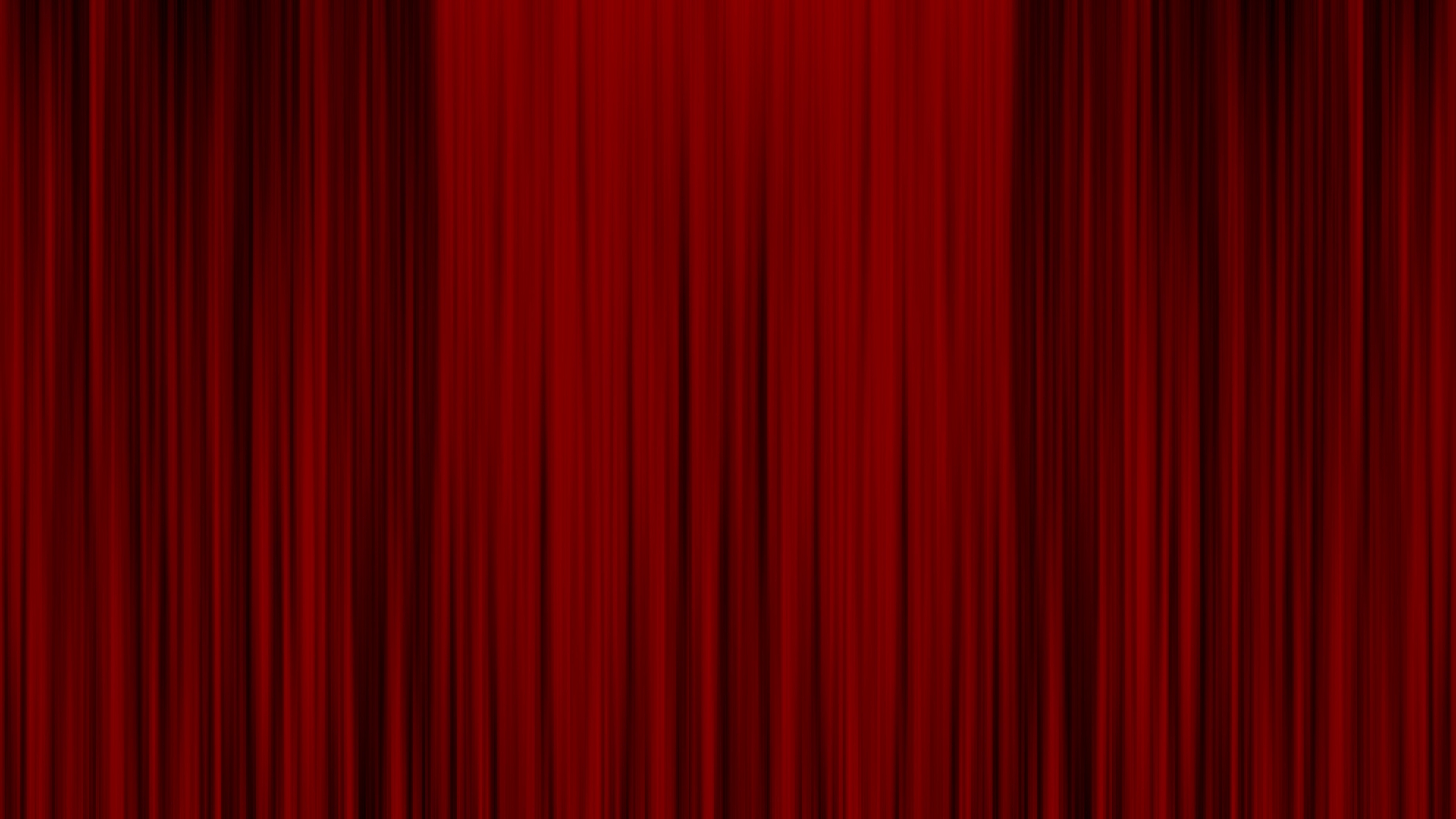Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Der belgische Dramatiker Tom Lanoye hat sich offenbar nicht vor dem Vorwurf der Rührseligkeit und des Drucks auf die Tränendrüsen gefürchtet, als er sein Stück schrieb „GAS – Plädoyer einer verurteilten Mutter“, in dem reichlich geweint wird, auf der Bühne wie im Zuschauerraum, und das als Gastspiel des Theaters Bremen bei den Autorentheatertagen zu erleben war.
Tom Lanoye erzeugt nicht einen Schock, sondern er löst einen Schock auf. Es ist ein schockierender Gedanke, der Mutter eines Attentäters zu begegnen, eines zum Islam konvertierten Fanatikers, der von Polizisten erschossen wurde, nachdem er 200 Menschen mit Giftgas getötet hatte. Mit der Trauer einer Frau um ein solches Monster möchte doch niemand etwas zu tun haben. Wenn sie nicht imstande ist, sich von diesem Sohn zu distanzieren, den vielfachen Mörder aus ihrem Leben zu streichen, dann ist das vielleicht verständlich jedoch kaum zu verzeihen. Mit ihrer Trauer bleibt sie dem Täter verbunden und schließt sich damit selbst aus der Gesellschaft aus, die mit den Angehörigen die Opfer beklagt. Es ist besser, einer solchen Frau aus dem Weg zu gehen.
Aber da sitzt sie, in der Box des Deutschen Theaters, in der sich Nähe zwischen Darstellerin und Publikum leicht herstellen lässt. Sie sitzt in ihrer Küche am Tisch in Jeans und einer bunt gemusterten Bluse. Vor ihr steht ein Becher mit Milchkaffee, den sie mit den Händen umschließt.
Fania Sorel beginnt zu sprechen. Sie erzählt von der Geburt ihres Sohnes, nach der sie sich, trotz der Schmerzen und nachdem er schließlich per Kaiserschnitt geholt werden musste, vollkommen gefühlt habe. Sie berichtet über seine Kindheit, auch über die Trotzphase, die sie mit ihm durchgestanden hat. Den Namen ihres Sohnes spricht sie nicht aus. Er war ein Kind und ein Jugendlicher wie alle anderen. Später, nach seinem Übertritt, hat er sich einen neuen Namen gegeben, den seine Mutter sich nicht merken wollte.
Eineinhalb Stunden lang spricht Fania Sorel. Meistens hat sie Tränen in den Augen. Sie ist kurz vor einem Zusammenbruch, aber sie hält sich aufrecht. Die Rede ist fast zu gut strukturiert, um von einer Frau in einer so verzweifelten Situation gehalten zu werden. Sie müsste sich doch wiederholen, aus dem Konzept geraten, plötzlich Unsinn reden.
Sie bemerkt ja nicht einmal, dass die Kanne in ihrer Kaffeemaschine überläuft, geht achtlos durch die Lachen auf dem Fußboden. Sie gießt Milch in ihren Kaffeebecher, der überfließt ohne dass sie darauf reagiert. Sie rührt einen Kuchen zusammen, schlägt Eier hinein und wirft dann ganze Eier mit der Schale dazu.
Diese Frau ist am Ende, hat niemanden mehr, mit dem sie reden könnte, wird von Reportern verfolgt und in den Medien angeprangert. Psychologen finden Erklärungen dafür, weshalb ausgerechnet dieser junge Mann zum Attentäter wurde. Aufwachsen ohne Vater ist Grund genug. Ein anderer behauptet, es sei der Kaiserschnitt gewesen, der eine Fehlentwicklung bewirkt habe.
Fania Sorel überzeugt mit dem Plädoyer, in dem alle Aspekte enthalten sind, unter denen der Fall dieser Frau, die wie ihr Sohn keinen Namen hat, betrachtet werden kann. Diese Mutter hat kein anderes Interesse, als ganz genau zu überprüfen, weshalb ihr Sohn zum Verbrecher werden konnte. Sie hat alles richtig machen wollen und kann nicht entdecken, wo sie versagt haben könnte. Hätte sie ihm verbieten sollen, dass er, wie alle seine Freunde, zu viel Zeit vor seinem Computer verbrachte? Er wurde nie auffällig, hat die Schule und ein Studium ordentlich abgeschlossen. Hätte sie ihn zurückhalten sollen als er, als erwachsener Mann, aus der Wohnung seiner Mutter auszog und ihm nachspionieren, als er sich nicht mehr bei ihr meldete?
Mit dem bärtigen Toten, der ihr in der Gerichtsmedizin gezeigt wurde, fühlt sie sich nicht verbunden, und seine Tat verabscheut sie. Sie trauert auch um die Menschen, die ihr Sohn ermordet hat und fühlt sich ihnen verbunden, auch wenn die nichts mit ihr zu tun haben wollen. Das Recht, das Kind, das sie kannte und aufgezogen hat, weiterhin zu lieben, will sie sich nicht nehmen lassen.
Fania Sorel hat mit ihrer Regisseurin Alice Zandwijk das eindringliche Porträt einer Frau geschaffen, die völlig unerwartet in eine schreckliche Situation gerät. Ausstatterin Nadine Geyersbach hat einen Trickfilm gestaltet, der die Vorstellung begleitet. Neben der Küche, in der die Mutter sitzt, ist ein leeres Zimmer mit einer Schrankwand. Dort erscheint mehrfach ein skizzierter Junge, der sich im Zimmer bewegt oder in einem ebenfalls skizzierten Bett liegt. Manchmal ist das schemenhaft gezeichnete Gesicht des Jungen durchgestrichen.
Die Tränen von Fania Sorel sind ansteckend, aber sie vernebeln das Hirn nicht. Ganz im Gegenteil bewirken sie die Auseinandersetzung mit den Vorurteilen und Schuldzuweisungen, mit denen wir alle es uns oft allzu leicht machen.


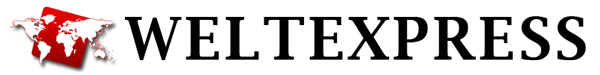



![[Hellas Filmbox] Gewaltiges Werk: Sounds of Vladivostok von Marios Joannou Elia ist ein Filmkonzert Der griechische, zypriotische oder griechisch-zypriotische Komponist Marios Joannou Elia von "Sounds of Vladivostok"](https://kulturexpresso.de/wp-content/uploads/2018/01/20180128_002601VeröKE-100x70.jpg)