Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). In die Eingeweide von Oberstleutnant Karl Deutinger führt die Suchaktion von zwei Bundeswehrsoldaten im Stück von Wolfram Lotz, das eigentlich ein Hörspiel ist, inspiriert von Joseph Conrad und Francis Ford Coppola. Ob dieses Werk höchst originell und politisch brisant oder eine eher harmlose Verulkung der rassistischen und kolonialistischen Klischees ist, die in…
Samstag, 14. März 2026
Ein Konto erstellen
Herzlich willkommen! Registrieren Sie sich für ein Konto
Ein Passwort wird Ihnen per Email zugeschickt.
Passwort-Wiederherstellung
Passwort zurücksetzen
Ein Passwort wird Ihnen per Email zugeschickt.


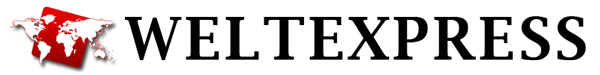




![[Hellas Filmbox] Gewaltiges Werk: Sounds of Vladivostok von Marios Joannou Elia ist ein Filmkonzert Der griechische, zypriotische oder griechisch-zypriotische Komponist Marios Joannou Elia von "Sounds of Vladivostok"](https://kulturexpresso.de/wp-content/uploads/2018/01/20180128_002601VeröKE-100x70.jpg)









