Salzburg, Österreich (Kulturexpresso). Kaum ein Theaterfreund kennt nicht die legendäre Aufführung des „Jedermann“ auf der Bühne vor dem Dom der Stadt Salzburg. Für den Schauspieler im deutschsprachigen Theater bedeutet das Spiel vor der eindrucksvollen Kulisse der Stadt an der Salzach eine Auszeichnung. Endlos scheint die Reihe der Schauspieler zu sein, die in Salzburg besonders in…
Samstag, 07. Februar 2026
Ein Konto erstellen
Herzlich willkommen! Registrieren Sie sich für ein Konto
Ein Passwort wird Ihnen per Email zugeschickt.
Passwort-Wiederherstellung
Passwort zurücksetzen
Ein Passwort wird Ihnen per Email zugeschickt.


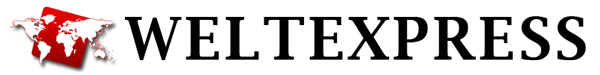




![[Hellas Filmbox] Gewaltiges Werk: Sounds of Vladivostok von Marios Joannou Elia ist ein Filmkonzert Der griechische, zypriotische oder griechisch-zypriotische Komponist Marios Joannou Elia von "Sounds of Vladivostok"](https://kulturexpresso.de/wp-content/uploads/2018/01/20180128_002601VeröKE-100x70.jpg)









