Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Die Junge Deutsche Philharmonie ist ein exzellenter Klangkörper, bestehend aus den 200 besten Musikstudenten im deutschsprachigen Raum. Sie bewerben sich mit einem Vorspiel um die Aufnahme in den Pool des Orchesters. 2022 wurden allein 49 Mitglieder neu aufgenommen. Dreimal im Jahr treffen sie sich zu »Arbeitsphasen», in denen Konzertprogramme entstehen. Die Auswahl…
Mittwoch, 25. Februar 2026
Ein Konto erstellen
Herzlich willkommen! Registrieren Sie sich für ein Konto
Ein Passwort wird Ihnen per Email zugeschickt.
Passwort-Wiederherstellung
Passwort zurücksetzen
Ein Passwort wird Ihnen per Email zugeschickt.


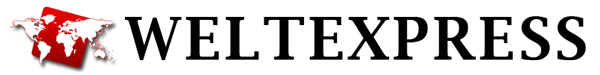




![[Hellas Filmbox] Gewaltiges Werk: Sounds of Vladivostok von Marios Joannou Elia ist ein Filmkonzert Der griechische, zypriotische oder griechisch-zypriotische Komponist Marios Joannou Elia von "Sounds of Vladivostok"](https://kulturexpresso.de/wp-content/uploads/2018/01/20180128_002601VeröKE-100x70.jpg)










