
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Das afrikanische Essensfest Berlin heißt original African Food Festival Berlin (AFFB). In Berlin führt der Weg nach Afrika übers Englische. Berlin ist eben keine Insel (mehr). Warum sollte das AFFB eine (tropische) Insel sein? A tropical island? Auch wenn wir alle verglobalisiert werden, oder nun aufgrund des Trumpschen Rückzugs aus G7 ja…

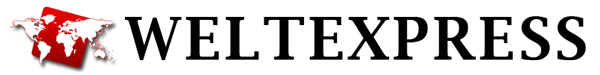




![[Hellas Filmbox] Gewaltiges Werk: Sounds of Vladivostok von Marios Joannou Elia ist ein Filmkonzert Der griechische, zypriotische oder griechisch-zypriotische Komponist Marios Joannou Elia von "Sounds of Vladivostok"](https://kulturexpresso.de/wp-content/uploads/2018/01/20180128_002601VeröKE-100x70.jpg)









